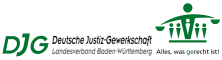Mittwoch, 12. November 2025 von RR
Mittwoch, 12. November 2025 von RR
DJG: Weihnachtsfeier in der Dienststelle
Freude feiern – Rechte kennen – Sicherheit wahren
Weihnachtsfeiern stärken das Miteinander in den Dienststellen und unter den Kolleginnen und Kollegen – sind aber kein rechtsfreier Raum. Dieser Leitfaden erklärt Einladungspflichten, Teilnahme, Arbeitszeit, Verhalten, Unfallversicherung und „Tag danach“ – klar, praxisnah und rechtssicher. In vielen Dienststellen gehört die Weihnachtsfeier zum Jahresausklang. Eine Pflicht, eine solche Veranstaltung durchzuführen, besteht jedoch nicht.
Einladung, Freiwilligkeit und Gleichbehandlung: Wer darf – und muss – zur Feier?
Die Dienststellenleitung entscheidet, ob eine Feier stattfindet. Selbst wenn in den Vorjahren regelmäßig gefeiert wurde, entsteht dadurch keine betriebliche Übung im Sinne eines einklagbaren Anspruchs – die gängige Rechtsprechung erkennt eine solche Übung im öffentlichen Dienst nicht an. Eine Verpflichtung kommt allenfalls in Betracht, wenn eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat die Durchführung vorsieht. Teilnahmezwang gibt es nicht. Weihnachtsfeiern sind freiwillig. Niemand kann dazu verpflichtet werden, erst recht nicht, wenn die Feier außerhalb der Arbeitszeit liegt. Findet sie innerhalb der Arbeitszeit statt, bleibt die Teilnahme trotzdem freiwillig. Wer nicht mitfeiern möchte, arbeitet regulär weiter – bis zum Ende der Arbeits- bzw. Kernarbeitszeit (bei Gleitzeit). Wer weder feiern noch arbeiten will, muss Urlaub oder Freizeitausgleich nehmen. Wichtig ist zudem die Gleichbehandlung: Grundsätzlich sind alle Beschäftigten einzuladen. Einzelne auszuschließen, ist nur bei sachlichem Grund zulässig (z. B. zwingende Bereitschaftsdienste oder konkrete Anhaltspunkte für erhebliche Störungen, wenn kein milderes Mittel greift). Diskriminierungen – etwa nach Herkunft oder Religion – sind tabu. Hier ist auch der Personalrat gefragt, auf Gleichbehandlung zu bestehen.
Zählt die Feier zur Arbeitszeit? Einordnungen für Gleitzeit, Nacharbeit und Entgelt
Für viele ist entscheidend, ob die Teilnahme Arbeitszeit ist – mit möglichen Auswirkungen auf Entgelt, Überstunden oder Nacharbeit. Grundsatz: Findet die Feier nach der regulären Arbeitszeit statt, gehört sie zur Freizeit; es entstehen keine Überstunden, kein Anspruch auf Bezahlung. Liegt die Feier während der regulären Arbeitszeit, ist die Teilnahme bis zum Ende der Arbeitszeit bezahlte Arbeitszeit. Danach – also über die reguläre Arbeitszeit hinaus – handelt es sich wieder um Freizeit. Möchte die Dienststellenleitung, dass die Feierzeit nachgearbeitet wird, muss sie das vorab anordnen und dabei den Personalrat beteiligen. Diese Vorab-Transparenz ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden und die Mitbestimmungsrechte zu wahren. Für Gleitzeitmodelle gilt: Wer nicht teilnimmt, bleibt im Dienst – mindestens bis zum Ende der Kernzeit. Eine „stille Freistellung“ für Nicht-Teilnehmende ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Klare interne Kommunikation hilft, Erwartungen zu steuern und Planungssicherheit zu schaffen.
Verhalten und Konsequenzen: Warum die Feier kein rechtsfreier Raum ist
Festliche Stimmung ändert nichts an arbeits- und dienstrechtlichen Pflichten. Beleidigungen, sexuelle Belästigungen oder Handgreiflichkeiten sind Pflichtverletzungen mit spürbaren Konsequenzen – von der Abmahnung bis zur (fristlosen) Kündigung. Die Rechtsprechung bestätigt dies seit langem, etwa bei sexueller Belästigung während der Feier, bei Schlägereien oder massiven Beleidigungen von Vorgesetzten in angetrunkenem Zustand. Solche Verfehlungen können – je nach Schwere – außerordentliche Kündigungen rechtfertigen, selbst bei langjähriger Betriebszugehörigkeit oder besonderer Funktion. Auch kommunikativ gilt Augenmaß: Die Weihnachtsfeier ist nicht der Ort, eine Beförderung oder Höhergruppierung einzufordern – rechtsverbindliche Zusagen sind dort nicht zu erwarten. Ebenso heikel: Fotos der Feier ohne Einwilligung der Abgebildeten in sozialen Netzwerken veröffentlichen.
Das kann Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Eine klare Foto-Policy der Dienststelle (z. B. Einwilligungsliste am Eingang) schafft Sicherheit. Prävention zahlt sich aus: Kurze Hinweise zu Umgangston, Alkohol und Respektgrenzen – am besten gemeinsam von Dienststellenleitung und Personalrat – helfen, Grenzüberschreitungen vorzubeugen. Ebenso sinnvoll: Benennung einer ansprechbaren Vertrauensperson für den Abend.
Versicherungsschutz: Wann die gesetzliche Unfallversicherung greift – und wann nicht
Weihnachtsfeiern sind betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen – sofern sie von der Dienststellenleitung veranstaltet oder ausdrücklich erlaubt sind und einem Gemeinschaftszweck dienen (Förderung des kollegialen Miteinanders). Dann besteht Unfallversicherungsschutz über die gesetzliche Unfallversicherung. Das gilt während der Veranstaltung (Essen, Tanzen, Spiele) ebenso wie für Vor- und Nachbereitung (Auf- und Abbau, Schmücken, Aufräumen). Der Ort ist unerheblich: Dienststelle, Restaurant oder sogar der Weihnachtsmarkt sind umfasst. Versichert sind außerdem der direkte Hin- und Rückweg – analog zum Arbeitsweg. Umwege aus privaten Gründen sind nicht gedeckt. Wer also erst noch privat Besorgungen macht oder „eine Runde dreht“, verlässt den versicherten Weg. Mit dem offiziellen Ende der Feier endet auch der Versicherungsschutz. Wird kein offizielles Ende verkündet, kann die Veranstaltung solange als andauernd gelten, wie die Dienststellenleitung erkennbar noch anwesend ist. Verliert die Feier den Charakter der Gemeinschaftsveranstaltung (nur noch wenige Personen feiern informell weiter), entfällt die Deckung. Gruppen, die sich absetzen, um andernorts weiterzufeiern, sind für diese Abspaltung ebenfalls nicht mehr versichert. Ein zentraler Sonderfall ist Alkohol: Führt Trunkenheit kausal zum Unfall – etwa auf dem Heimweg –, kann der Unfallversicherungsschutz entfallen. Die sozialgerichtliche Rechtsprechung hat das wiederholt klargestellt; maßgeblich ist die Ursächlichkeit des Alkohols für den Unfallhergang.
Rolle von Dienststellenleitung und Personalrat: Regeln festlegen, Kultur stärken
Gute Feiern sind gut vorbereitet – in Inhalt und Rechtsrahmen. Die Dienststellenleitung sorgt für Einladung und Organisation; der Personalrat achtet auf Gleichbehandlung, Mitbestimmung und Transparenz. Empfehlenswert ist eine kurze Orientierung im Vorfeld:
• Einladungspolitik: Alle Beschäftigten werden eingeladen; Ausnahmen werden begründet (z. B. unvermeidbare Dienstverpflichtungen), Diskriminierungsverbote sind strikt einzuhalten.
• Arbeitszeitklarheit: Ist die Feier Arbeitszeit (bis zum regulären Ende) oder Freizeit? Gilt Nacharbeit – und wenn ja, wurde sie vorab angeordnet und der Personalrat beteiligt?
• Verhaltenshinweise: Kurzer Hinweis zu Respekt, Alkohol, Nulltoleranz bei Belästigung/Beleidigung; Benennung von Ansprechpersonen.
• Foto- und Social-Media-Regeln: Einwilligung vor Veröffentlichung; ggf. Hausregel, dass nur ein offizieller Event-Rückblick über interne Kanäle erfolgt.
• Versicherungsschutz: Hinweis auf direkten Weg, offizielles Ende, Abspaltungen und Alkoholrisiken.
Solche Leitplanken sind nicht bürokratisch, sondern schutzstiftend: Sie fördern Wertschätzung, Sicherheit und ein gemeinsames Verständnis – und helfen, den eigentlichen Zweck der Feier zu erreichen: kollegiale Verbundenheit.
Praxis-Checkliste: So gelingt die rechtssichere, wertschätzende Weihnachtsfeier
Zum Schluss die wichtigsten Punkte kompakt – als Gedächtnisstütze für Dienststellenleitung, Personalrat und Teams:
1. Ziel klären: Gemeinschaft fördern – nicht „Pflichtprogramm“. Freiwilligkeit betonen.
2. Einladung an alle – Gleichbehandlung beachten; Ausnahmen nur mit sachlichem Grund (z. B. unvermeidbare Dienste). Keine Diskriminierung.
3. Arbeitszeit sauber regeln: Zeitpunkt, Bezahlstatus bis zum regulären Ende, ggf. Nacharbeit – vorab anordnen, Personalrat beteiligen.
4. Verhaltensleitplanken: Kurz und freundlich – Respekt, Nulltoleranz bei Belästigung/Beleidigung, Ansprechpersonen benennen.
5. Foto-/Social-Media-Policy: Einwilligungen einholen; offizielle Bildauswahl zentral veröffentlichen.
6. Unfallversicherung: Offizieller Charakter, Vor-/Nachbereitung umfasst, direkter Weg – Umwege privat. Alkoholrisiko beachten.
7. Offizielles Ende festhalten: Versicherungsschutz endet mit Verkündigung bzw. wenn der Gemeinschaftscharakter wegfällt. Abspaltungen sind nicht gedeckt.
8. Der Morgen danach: Regulärer Arbeitsbeginn; Kater kann Lohnfortzahlung gefährden, wenn selbst verschuldet.
Diese Punkte schaffen Planbarkeit und Sicherheit – und lassen mehr Raum für das, was zählt: gemeinsam das Jahr würdig ausklingen zu lassen.