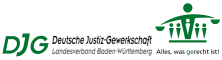Mittwoch, 19. November 2025 von RR
Mittwoch, 19. November 2025 von RR
DJG: Loyalität oder Selbstaufgabe?
Warum Beamtinnen und Beamte mehr Selbstbewusstsein brauchen
Beamtinnen und Beamte gelten als Rückgrat des Staates. Sie sollen unabhängig, loyal und dem Gemeinwohl verpflichtet handeln. Doch in der Praxis führt das System oft zu Angst, Anpassung und Schweigen. Bei vielen Staatsdienern ist längst die innere Kündigung erfolgt. Psychische Krankheitsbilder und Fehltag sind die Folge. Dieser Beitrag beleuchtet, warum das so ist – und weshalb es dringend ein neues Selbstverständnis braucht.
Zwischen Loyalität und Unterwürfigkeit – ein gefährliches Spannungsfeld
Das Beamtenverhältnis ist kein gewöhnliches Arbeitsverhältnis. Es ist geprägt von besonderen Pflichten: Dienst- und Treuepflicht, Weisungsgebundenheit und das Streikverbot. Diese Regeln sollen die Funktionsfähigkeit des Staates sichern. Im Gegenzug gewährt der Dienstherr Fürsorge, Versorgung und Schutz. Doch neben diesen juristischen Grundlagen wirken unausgesprochene Kräfte – psychologische Mechanismen, die Angst und Unterordnung fördern. Viele Beamtinnen und Beamte wissen: Wer aneckt, riskiert Nachteile. Wer zu loyal ist, verliert oft die eigene Stimme. Das führt dazu, dass Loyalität nicht selten mit Gehorsam verwechselt wird. Statt selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen, entstehen Strukturen, in denen Kritik vermieden und Anpassung belohnt wird.
Strukturen, die Angst fördern
Die Verwaltung ist hierarchisch aufgebaut. Entscheidungen laufen über viele Ebenen, Verantwortung ist selten klar verteilt. Dieses System begünstigt Machtgefälle und Abhängigkeiten. Wer in der Karriere vorankommen möchte, weiß: Die entscheidende Beurteilung schreibt der oder die Vorgesetzte. Und genau dort liegt das Problem. Beurteilungen sind selten objektiv. Sie spiegeln nicht nur Leistung wider, sondern oft auch persönliche Beziehungen oder Loyalität. Dazu kommt, dass Beförderungsmöglichkeiten begrenzt sind. Die Bezahlung folgt festen Besoldungsstufen, nicht echter Leistung. Das schafft ein Klima der Konkurrenz, in dem Zustimmung oft mehr zählt als Engagement. Wenn dann Führungspositionen nach Parteizugehörigkeit oder Gefälligkeit vergeben werden, wächst das Misstrauen – und der Mut, Missstände anzusprechen, sinkt weiter.
Wenn Loyalität zum Nachteil wird
Loyalität ist eine Tugend. Sie soll Vertrauen und Stabilität schaffen. Doch falsch verstandene Loyalität kann zerstörerisch wirken. Viele Beamtinnen und Beamte ordnen sich aus Angst unter – nicht aus Überzeugung, sondern aus Sorge vor Sanktionen. Dabei sind sie eigentlich unkündbar. Wovor also die Angst? Die Antwort liegt in den Strukturen: Wer in Ungnade fällt, wird versetzt, isoliert oder bei künftigen Beurteilungen schlechter gestellt. Es geht weniger um den Status als um den Alltag – um Aufgaben, Anerkennung, das Arbeitsklima. So entsteht eine Kultur, in der Loyalität mit Selbstaufgabe bezahlt wird. Statt unabhängiger Sachwalter des Gemeinwohls zu sein, werden Beschäftigte zu stillen Mitläufern.
Fehlende Führungskultur als Kernproblem
Gute Führung ist das Rückgrat jeder Organisation – auch in der Justiz und Verwaltung. Doch viele Führungskräfte werden wegen fachlicher Qualifikation befördert, nicht wegen sozialer Kompetenz. Wer Menschen führen soll, braucht Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Fehlt das, entstehen Abhängigkeiten, Misstrauen und Frustration. Führung im öffentlichen Dienst sollte Mitarbeitende stärken, nicht verunsichern. Doch allzu oft erleben Beschäftigte das Gegenteil: mangelnde Wertschätzung, fehlende Transparenz und Druck von oben. Die Folge sind Dienst nach Vorschrift, innere Kündigung und ein Verlust an Motivation. Eine moderne Verwaltung braucht Führung, die auf Vertrauen, Respekt und Beteiligung setzt.
Recht haben heißt nicht Recht bekommen
Rein theoretisch haben Beamte viele Möglichkeiten, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren – von der Konkurrentenklage bis zur Remonstration. In der Praxis ist das jedoch selten erfolgreich. Wer gegen eine Auswahlentscheidung oder Beurteilung vorgeht, trägt die Beweislast und steht gegen die eigene Behörde. Selbst wenn ein Gericht formale Fehler feststellt, führt das meist nur zu einer Wiederholung des Verfahrens, nicht zur Beförderung. Diese Aussichtslosigkeit verstärkt das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Nur wenige Beamtinnen und Beamte klagen überhaupt – aus Angst, sich dauerhaft unbeliebt zu machen. Damit bleiben systematische Probleme bestehen. Gerade deshalb ist kollektives Handeln so wichtig: Nur wer sich zusammenschließt, kann Strukturen verändern.
Fazit
Das Beamtentum braucht keine blinde Loyalität, sondern kluge, mutige Menschen, die Verantwortung übernehmen. Die Strukturen des öffentlichen Dienstes können nur dann besser werden, wenn Beschäftigte sich ihrer Stärke bewusst sind und gemeinsam für eine Kultur der Offenheit eintreten. Loyalität darf nie zur Selbstaufgabe führen – sie muss Ausdruck von Haltung und Selbstachtung sein.
Reinhard Ringwald
Landesehrenvorsitzender DJG-BW
Quellen:
Recherchen im Internet, Printmedien