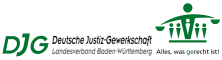Zielvereinbarungen

 Donnerstag, 9. Januar 2025 von PH
Donnerstag, 9. Januar 2025 von PH
GV: Zielvereinbarungen im Gerichtsvollzieherdienst: Ein Instrument mit Risiken und Nebenwirkungen
Zielvereinbarungen - Steuerungsmethode mit Vorsicht zu genießen?
Zielvereinbarungen, ursprünglich ein Konzept aus der freien Wirtschaft, finden zunehmend Einzug in den öffentlichen Dienst. Auch Gerichtsvollzieher sehen sich vermehrt mit dieser Steuerungsmethode konfrontiert. Die Idee dahinter: klare Ziele sollen die Effizienz steigern, die Eigenverantwortung stärken und messbare Ergebnisse liefern. Doch die Praxis zeigt, dass Zielvereinbarungen gerade im hoheitlichen Bereich erhebliche Probleme mit sich bringen können. Nachstehend beleuchten wir, welche Herausforderungen Zielvereinbarungen für Gerichtsvollzieher darstellen, wo die Grenzen des Instruments liegen und was die betroffenen Beamten wissen sollten.
Was sind Zielvereinbarungen und warum werden sie eingeführt?
Zielvereinbarungen sind Absprachen zwischen einer Führungskraft und dem Beamten über die Erreichung bestimmter Ziele innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums. Diese Ziele sollen spezifisch, messbar und zeitlich begrenzt sein. Anders als Weisungen, die top-down erteilt werden, sollen Zielvereinbarungen offiziell auf Freiwilligkeit beruhen und im Dialog entstehen.
Die Einführung von Zielvereinbarungen im öffentlichen Dienst wird häufig mit folgenden Argumenten begründet:
Transparenz und Struktur: Klare Vorgaben sollen die Arbeit erleichtern und Prioritäten setzen.
Motivation und Eigenverantwortung: Beamte sollen sich stärker in die Zielsetzung einbringen und Verantwortung übernehmen.
Effizienzsteigerung: Behördenleitung und Führungskräfte sollen besser steuern können, indem sie die Zielerreichung messen.
Doch die Umsetzung dieses Konzepts in einem rechtlich und organisatorisch hochregulierten Berufsfeld wie dem des Gerichtsvollziehers ist alles andere als unproblematisch.
1. Unvereinbarkeit mit der hoheitlichen Aufgabe
Gerichtsvollzieher erfüllen eine hoheitliche Funktion, die durch Neutralität, Genauigkeit und gesetzliche Bindung geprägt ist. Zielvereinbarungen, die primär auf Effizienz oder Quoten abzielen, stehen in direktem Widerspruch zu diesen Grundprinzipien. Beispielsweise könnte die Vorgabe, eine bestimmte Anzahl von Fällen innerhalb eines Zeitraums abzuschließen, dazu führen, dass Vollstreckungsmaßnahmen beschleunigt oder unzureichend geprüft werden. Die Qualität der Arbeit würde darunter leiden – mit potenziell gravierenden Folgen für alle Beteiligten. Ebenfalls dürfen Zielvereinbarungen die Arbeit des Gerichtsvollziehers weder einschränken noch gesetzliche Vorgaben ignorieren.
2. Unrealistische und starre Zielvorgaben
Ein häufiger Kritikpunkt an Zielvereinbarungen ist, dass sie nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen berücksichtigen. Gerichtsvollzieher sind mit einer Vielzahl unvorhersehbarer Faktoren konfrontiert, etwa:
Die Komplexität der Fälle: Ein einzelner Fall kann erheblich mehr Zeit und Ressourcen erfordern als geplant.
Externe Einflüsse: Schuldnerverhalten, gesetzliche Änderungen oder fehlende personelle und technische Unterstützung beeinflussen den Arbeitsablauf, ohne dass dies bei der Zielsetzung berücksichtigt wird.
3. Subtile Kontrolle und erhöhter Arbeitsdruck
Auch wenn Zielvereinbarungen offiziell auf Freiwilligkeit beruhen, erleben viele Gerichtsvollzieher die Einführung solcher Instrumente als Kontrollmechanismus. Die regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung erzeugt zusätzlichen Druck und schafft ein Klima des Misstrauens. Beamte, die ihre Ziele nicht erreichen, könnten negativ bewertet werden – unabhängig davon, ob die Gründe dafür in ihrem Einflussbereich lagen oder nicht.
4. Fehlende Passgenauigkeit
Die Tätigkeiten von Gerichtsvollziehern sind stark durch rechtliche Vorgaben standardisiert. Zielvereinbarungen, die aus der Privatwirtschaft übernommen wurden, passen häufig nicht zu den besonderen Anforderungen und dem Arbeitsalltag dieser Berufsgruppe. Die Übertragung von Konzepten wie „Ergebnisorientierung“ oder „Effizienzsteigerung“ auf einen hoheitlich agierenden Beruf führt zwangsläufig zu Konflikten.
Empfehlungen: Wie sollten Gerichtsvollzieher mit Zielvereinbarungen umgehen?
Falls Ihnen als Gerichtsvollzieher eine Zielvereinbarung vorgelegt wird, sollten Sie umsichtig und selbstbewusst agieren:
Prüfen Sie die Ziele kritisch:
- Sind die Ziele realistisch und mit Ihrer Tätigkeit vereinbar?
- Berücksichtigen sie die Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit?Verhandeln Sie bei Unklarheiten:
Zielvereinbarungen sind keine Einbahnstraße. Scheuen Sie sich nicht, Änderungen oder Anpassungen vorzuschlagen.Beratung in Anspruch nehmen:
Ziehen Sie Ihren Personalrat oder Ihre Gewerkschaft hinzu, wenn Sie Zweifel an der Vereinbarung haben. Sie haben das Recht auf Unterstützung und rechtliche Klärung.Setzen Sie auf Transparenz:
Kommunizieren Sie, wenn äußere Faktoren die Zielerreichung beeinflussen. Dokumentieren Sie Hindernisse, um Missverständnisse zu vermeiden.Freiwilligkeit betonen:
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Zielvereinbarungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie tatsächlich im gegenseitigen Einvernehmen entstehen.
Fazit: Zielvereinbarungen sind kein Allheilmittel
Zielvereinbarungen mögen in der Privatwirtschaft oder in bestimmten Bereichen des öffentlichen Dienstes sinnvoll sein, doch ihre Übertragung auf den Gerichtsvollzieherdienst ist problematisch. Die spezifischen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen dieser Berufsgruppe stehen oft im Widerspruch zu den Zielen, die mit diesem Instrument verfolgt werden.
Gerichtsvollzieher sollten Zielvereinbarungen daher kritisch prüfen und sich nicht scheuen, ihre Bedenken zu äußern oder Unterstützung einzufordern. Letztlich müssen Zielvereinbarungen die Arbeitsrealität widerspiegeln und dürfen nicht zu zusätzlichem Druck oder einer Gefährdung der Arbeitsqualität führen. Wo dies nicht gewährleistet ist, sollte auf dieses Instrument verzichtet werden – im Interesse der Beamten und der Qualität ihrer hoheitlichen Arbeit.
„Der Druck, Ziele zu erreichen, darf niemals die Neutralität und Sorgfalt ersetzen, die die Grundlage unseres Berufs ausmachen.“